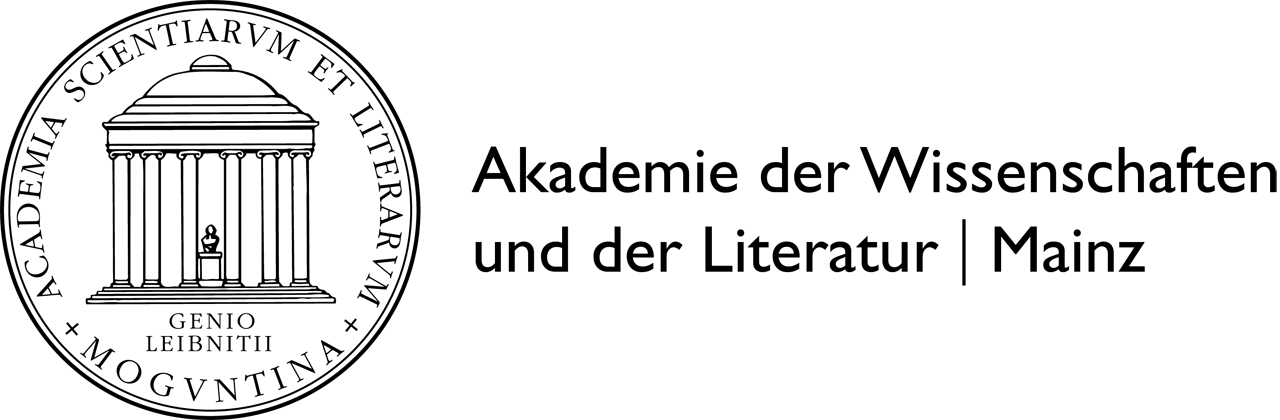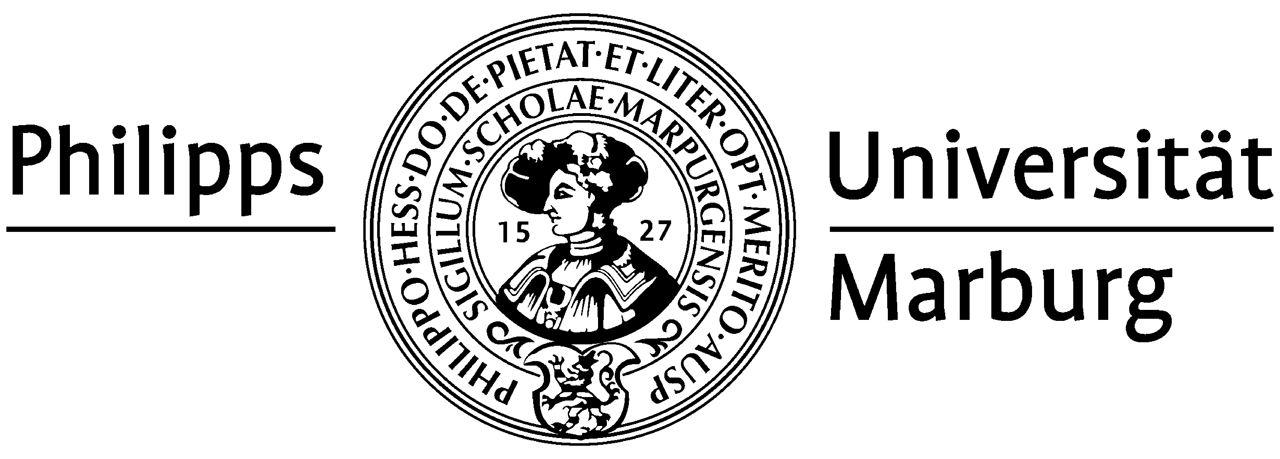| Abbildungen | - Angerer zwischen S. 18/19 [= vollständig]
- Diehr S. 67 [= Bl. 2r, stark verkleinert]
- Farb-Abbildung im Internet [= vollständig]
|
|---|
| Literatur | - Joachim F. Angerer, Lateinische und deutsche Gesänge aus der Zeit der Melker Reform. Probleme der Notation und des Rhythmus, bezogen auf den historischen Hintergrund und verbunden mit einer Edition der wichtigsten, durch die Reform eingeführten Melodien (Forschungen zur älteren Musikgeschichte 2), Wien 1979, S. 7-23 (mit Abdruck) (als Fragment A bezeichnet).
- Karl Stackmann und Karl Bertau (Hg.), Frauenlob (Heinrich von Meissen). Leichs, Sangsprüche, Lieder. Auf Grund der Vorarbeiten von Helmuth Thomas, 2 Teile (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philol.-Hist. Klasse III,119.120), Göttingen 1981, S. 146-148 (Nr. 31), 219-222.
- Franz-Josef Holznagel, Wege in die Schriftlichkeit. Untersuchungen und Materialien zur Überlieferung der mittelhochdeutschen Lyrik (Bibliotheca Germanica 32), Tübingen/Basel 1995, S. 39, 46.
- Joachim Heinzle und Klaus Klein, Zu den Melker Fragmenten des 'Nibelungenlieds', in: ZfdA 127 (1998), S. 373-380, hier S. 377, Anm. 28.
- Achim Diehr, Literatur und Musik im Mittelalter. Eine Einführung, Berlin 2004, S. 67f., 132.
- manuscripta.at - Mittelalterliche Handschriften in österreichischen Bibliotheken. [online] [zur Beschreibung]
|
|---|
| Archivbeschreibung | --- |
|---|
| Ergänzender Hinweis | Das Doppelblatt war - bisher unbekannt - früher Vorderdeckel-Spiegelblatt der Handschrift Melk, Stiftsbibl., Cod. 208 (olim 272; E 63), entspricht MBKÖ I, 229 Z. 14f.; der obere Blattrand des Fragments befindet sich heute noch als Falz in diesem Codex (Teile der Notation zu 6,1 und 8,1 sowie 18,9-11 und Text 19,29ff. [?, nicht genau erkennbar]); das im unteren Teil von Bl. 2 ausgerissene dreieckige Pergamentstück ist noch auf dem Einbanddeckel der Trägerhandschrift erhalten (19,17 solher slahten; 19,20 er), nicht jedoch das an der oberen äußeren Ecke von Bl. 2 fehlende, größere ovale Stück (aus dem Textbereich 18,10-19,1 und 19,29-20,1). - Der auf einem mit dem Fragment aufbewahrten Beiblatt genannte Melker Cod. 520 war schon von Stackmann/Bertau (S. 146) als ehemaliger Trägercodex ausgeschieden worden.
Trägerhandschrift (Papier, 310 x 210 mm; Inhalt: Thomas de Chobham, Summa confessorum; Paulus Kölner, Sermones de communi sanctorum) datiert 1422 (p. 227 und 435), geschrieben von Paulus Sydendorffer de Lewczesdorff (vermutlich Leitzersdorf, Gerichtsbez. Stockerau/Niederösterreich). - Lokalisierung: wohl Ostösterreich (Niederösterreich oder Wien). Aus dem Kolophon auf p. 227 ist möglicherweise auf einen Vorbesitzer oder Auftraggeber 'Egidius dominus' zu schließen: Anno domini M° CCCC° nono [korrigiert zu: 22] ffinitus est liber iste qui dicitur Summa casuum in die sancte Agathe per manus Pauli de Layczezdarff Pataviensis dyocesis domini Egidii. - Schmuckloser Rauhledereinband über Holz; auf dem Hinterdeckel-Spiegel früher ein hebräisches Fragment (jetzt abgelöst: Melk, Fragm. hebr. XVI), Fälze in den Lagenmitten aus einer (weiteren ?) hebräischen Handschrift. - Die genannten Indizien sprechen eher gegen als für eine Niederschrift (und Bindung ?) der Handschrift in Melk. - Schließt man von der Datierung der Handschrift auf jene des Einbandes, so ist die Makulierung der Liederhandschrift spätestens ca. 1422 anzusetzen. |
|---|